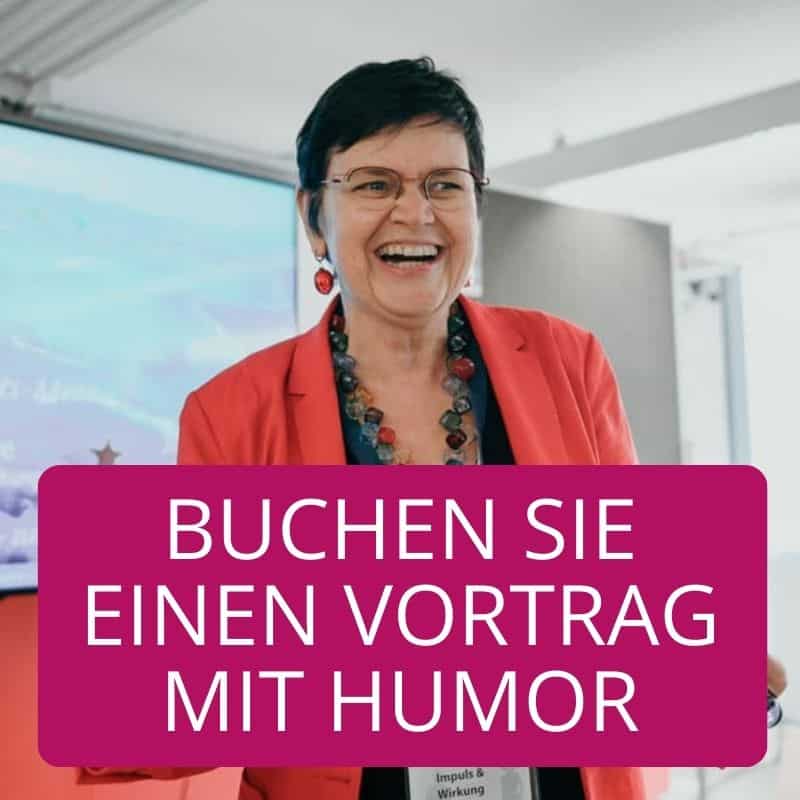Am Beginn des 20. Jahrhunderts haben die Physiker*innen den Laplaceschen Dämon demütig zu Grabe getragen. Doch bis in Management-Etagen hat sich das noch nicht herumgesprochen. Dort schwelgt man häufig noch in den Allmachtsfantasien der Zahlengläubigkeit. Dieser vermeintlichen Sicherheit zu vertrauen, kann in unserer disruptiven Welt in den Abgrund führen.
Der Laplacsche Dämon
Dieser Dämon war einst das Sinnbild menschlicher Allmachtsfantasien – die Projektion des Wunsches, alles zu wissen, zu verstehen und zu kontrollieren. Pierre-Simon Laplace stellte sich im 18. Jahrhundert ein übernatürlich intelligentes Wesen vor, das in einem einzigen Moment alle Naturgesetze kennt und die Position und Bewegung sämtlicher Teilchen des Universums erfassen kann. Mit diesem Wissen, so glaubte er, könnte es Vergangenheit und Zukunft vollständig berechnen – die Welt als gigantische, perfekt determinierte Maschine. Kein Platz für Zufall, keine Freiheit, keine Überraschung. Der Laplacesche Dämon steht für die Hybris der Vernunft: die Überzeugung, dass Wissen gleich Macht und Kontrolle bedeutet.
In der Physik gestorben
Doch im Laufe der Wissenschaftsgeschichte zeigte sich, dass diese Vorstellung zu eng, zu mechanistisch, zu menschlich war. Mit der Quantenphysik wurde die Welt unberechenbarer. Auf subatomarer Ebene gelten andere Gesetze: Teilchen verhalten sich nicht deterministisch, sondern probabilistisch, d.h. gemäß ‚Wahrscheinlichkeiten. Wir können nicht gleichzeitig ihren exakten Ort und ihre Geschwindigkeit bestimmen – die Heisenbergsche Unschärferelation ist keine technische Grenze, sondern ein Naturprinzip.
Zufall – die unterschätzte Kraft
Zufall ist kein Zeichen für Unwissenheit, sondern Teil der Struktur des Universums. Der Laplacesche Dämon musste erkennen, dass es ihn nicht geben kann. Niemand kann allwissend sein – die Natur selbst schützt ihr Geheimnis.
Im Zuge meines Physik-Studiums habe ich auch ein Privatissimum absolviert. 2 Stunden pro Woche. Ein Semester lang. Thema des Privatissimums, an dem einige Professor*innen, Dozent*innen und ich teilnahmen: „Kann es verborgene Parameter geben?“ Die Fragestellung, die mathematisch bearbeitet wurde: Ist die Heissenbergsche Unschärferelation ein messtechisches Problem – Die Wirklich ist determiniert und wir können sie nicht ganz genau messen. In der Physik spricht man von Einsteins Schleier: Die Welt ist verschleiert und zeigt sich nicht klar. Oder ist die Welt prinzipiell nicht genau determiniert – Die Welt flimmert.? Das Ergebnis nach zig Stunden Mathematik: Je nachdem welche Annahme man den Regeln der Naturgesetze zu Grunde legt, gilt das Eine oder das Andere.
Für viele mag dies befremdlich oder sogar frustrierend sein. Ich war begeistert von diesem Resultat: Es sind immer die menschlichen Annahmen, die die Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmen.
Mehrere widersprüchliche Wirklichkeiten
Ja, ich habe als Physikerin ein zu tiefst konstruktivistisches Weltbild: Es gibt keine Wirklichkeit ohne Beobachtung. Die Beobachter*innen sind immer Teil vom System und haben daher Einfluss auf die beobachtete Wirklichkeit. Daraus folgt, dass es unterschiedliche Wirklichkeiten und Wahrheiten gibt. Übrigens ich habe mich für das Physikstudium entschieden, weil mich zunächst als 12-jährige die elektrische Klingel mit ihrer zyklischen Funktionsweise fasziniert: Jedes Mal, wenn der Anker vom Magneten angezogen ist, unterbricht das den Stromkreis und damit die magnetische Wirkung, sodass der Anker wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Mit 15 Jahren habe ich dann „Spezielle Relativitätstheorie für Jedermann“ gelesen. Der Eine erkennt, dass das Ereignis A vor B stattfindet, der Andere beobachtet, dass B vor A stattfindet und der Dritte nimmt wahr, dass die beiden Ereignisse gleichzeitig stattfinden. Mathematik habe ich unter anderem studiert, weil ich mich immer noch diebisch freue, dass 0 Milligramm gleich schwer wie 0 Tonnen sind und 0 Millimeter gleich groß wie 0 Lichtjahre. Null der Zwilling der Unendlichkeit, wie auch der Titel eines Buches lautet.
Diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Wahrheiten fasziniert mich immer noch. Man spricht von anti-dichotomischem Denken. Dichotomisches Denken unterscheidet nur „wahr“ oder „falsch“. Tertium non datur. Es gibt kein Drittes. Doch seit dem frühen 20. Jahrhundert ist in die Physik das Denken in Widersprüchlichkeiten unerlässlich um die beobachteten Phänomene zu erklären. Für unsere Welt im Umbruch ist diese Kompetenz höchst wertvoll.
Eindeutige Falschheiten
UND: Es gibt eindeutige Falschheiten. Dass das geozentrische Weltbild mit der flachen Erde widerlegt und durch das heliozentrische Weltbild mit einer annähernd kugelförmigen Erde abgelöst wurde, ist nicht Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern ist ein naturwissenschaftlich fundiertes Faktum. Auch wenn in den USA neuerdings die Flat Earth Society in letzter Zeit enormen Zulauf hat.
Wahrscheinlichkeits-Potentiale
Hartnäckig hält sich bis heute das Rutherford’sche Atommodell, das die meisten noch aus der Schule kennen: winzige Elektronen, die wie kleine Planeten um den Atomkern kreisen. Dieses Bild ist anschaulich – aber falsch. Schon bald nach Ernest Rutherfords Entdeckung widerlegte die Quantenphysik diese Vorstellung. Wenn Elektronen tatsächlich wie Planeten auf festen Bahnen kreisen würden, müssten sie durch ihre Beschleunigung ständig Energie abstrahlen – und schließlich in den Atomkern stürzen. Doch das geschieht nicht.
Stattdessen zeigte das Bohr’sche Atommodell zunächst, dass Elektronen nur bestimmte Energieniveaus einnehmen können. Und mit der Quantenphysik wurde das noch weiter verfeinert: Elektronen sind keine winzigen Kugeln, die auf festen Bahnen kreisen, sondern sie bilden sogenannte Wahrscheinlichkeitsorbitale – also Bereiche, in denen sie sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aufhalten. Der „Ort“ eines Elektrons ist damit kein Punkt mehr, sondern eine Wahrscheinlichkeitswolke. Die Materie selbst ist nicht fest und berechenbar, sondern fließend, unscharf, dynamisch. Selbst das, was wir für stabil und greifbar halten, besteht aus Ungewissheit – die nur in ihrer Gesamtheit ein stabiles Ganzes ergibt.
Die Grenzen der Messbarkeit
Dann kam die Chaostheorie: Sie machte deutlich, dass auch in der makroskopischen Welt winzige Unterschiede in den Anfangsbedingungen enorme Konsequenzen haben können. Der berühmte „Schmetterlingseffekt“ zeigt, dass aus kleinsten Abweichungen unvorhersehbare Entwicklungen entstehen. Damit ist selbst das scheinbar Berechenbare auf lange Sicht nicht planbar.
Ein besonders anschauliches Beispiel liefert das sogenannte Küstenparadoxon: Man kann die Küstenlänge von Norwegen nicht exakt messen. Je genauer man misst, desto länger wird sie – weil man immer mehr Buchten, Vorsprünge und Kurven berücksichtigt. Und wenn man schließlich beginnt, die Bögen um jedes einzelne Sandkorn zu vermessen, ist die Küste praktisch unendlich lang. Das zeigt: Je präziser wir messen wollen, desto unüberschaubarer wird die Wirklichkeit.
Pseudo-Messbarkeit
Diese Einsicht ist nicht nur physikalisch bedeutsam, sondern auch philosophisch und gesellschaftlich. Galileo Galilei wird der Ausspruch zugeschrieben: „Messen, was messbar ist. Messbar machen, was noch nicht messbar ist.“ Doch dabei fehlt ein entscheidender Zusatz: „Nur das messbar machen, was sinnvoll messbar zu machen ist.“ Nicht alles, was gezählt werden kann, hat Bedeutung – und nicht alles, was Bedeutung hat, lässt sich zählen. Albert Einstein formulierte es prägnant:
Häufig können wir das, was zählt, nicht zählen.
Und das, was wir zählen können, zählt nicht.
Damit traf er den Nerv unserer heutigen Zeit: die Verwechslung von Präzision mit Aussagekraft.
Zahlenirrglaube im Management
In der Physik ist der Laplacesche Dämon also tot. Doch in der Unternehmensführung lebt er fort – quicklebendig, charmant und digitalisiert. Dort tritt er auf in Gestalt von Excel-Tabellen, KPI-Dashboards und Big-Data-Algorithmen. Der Glaube, mit genügend Daten könne man alles vorhersagen und steuern, ist die moderne Variante des alten Determinismus. In vielen Organisationen herrscht die Illusion, dass die Zahlenkontrolle gleich Sicherheit bedeutet. Doch wie die Physik zeigt, ist Kontrolle in komplexen Systemen immer eine Fiktion. Menschen, Märkte und Organisationen sind keine Maschinen – sie sind lebendige, dynamische Netzwerke mit Eigenlogiken, Emotionen und Wechselwirkungen. Dazu der Quantenphysiker, Philosoph und Friedensaktivist Hans-Peter Dürr, der den Alternativen Nobelpreis erhielt:
Wir leben im 21. Jahrhundert
mit der Technologie des 20. Jahrhunderts
und wollen die heutigen Probleme
mit dem Denken des 19. Jahrhunderts lösen.
Das kann nur in den Graben gehen.
An dieser Stelle passt der geistreiche Witz, den Paul Watzlawick in seinen Schriften erzählt:
Ein Betrunkener sucht in der Nacht verzweifelt unter einer Laterne seinen Schlüsselbund. Ein Polizist kommt vorbei und hilft ihm beim Suchen. Nach einer Weile, als sie nichts finden, fragt der Polizist: „Sind Sie sicher, dass Sie ihn hier verloren haben?“ – „Nein“, sagt der Betrunkene, „ich habe ihn im Straßengraben auf der anderen Straßenseite verloren.“ – „Und warum suchen Sie dann hier?“ – „Weil es hier so hell ist.“
Diese Geschichte ist mehr als eine humorvolle Fiktion – er ist eine tiefgründige Metapher. Wir suchen oft dort, wo es hell ist, wo die Daten klar und die Zahlen leicht zugänglich sind – nicht dort, wo die eigentlichen Antworten liegen.
Systemisches Denken
In der Physik ist die Zahlengläubigkeit dem systemischem Denken gewichen. Und auch in Unternehmen greift das Steuern anhand einzelner Kennzahlen zu kurz. Als Statistikerin weiß ich, wenn man als „Narren des Zufalls“ punktuell, jeweils gegensteuert, verdoppelt dies die Streuung, d.h. die Volatilität und damit die Nichtvorhersagbarkeit des Systems. Wie in der modernen Physik schon selbstverständlich braucht es auch in Unternehmen systemisches Denken: nicht einzelne Aspekte, sondern die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Aspekten als Steuerungsgrundlage nutzen.
Wer heute führt, sollte weniger wie der Laplacesche Dämon rechnen und mehr wie erfahrene Navigator*innen agieren. Komplexität lässt sich nicht bezwingen, aber gestalten. Sie fordert Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und intelligente Intuition statt starrem Planen. Führung im 21. Jahrhundert heißt, mit Unschärfe zu leben, Resonanz zu schaffen und das Potenzial des Unvorhersehbaren als Chancen zu nutzen.
Der Laplacesche Dämon wollte alles wissen, um alles zu bestimmen. Doch die kluge Führungskraft hütet sich vor der Scheinsicherheit exakter Zahlen. Wenn wir die Welt wieder als System voller Wechselwirkungen begreifen statt als Ursache-Wirkungs-Maschine, wird Führung zu einer Kunstfertigkeit – der Kunst, trotz der Unsicherheiten unserer Welt im Umbruch Orientierung zu bieten. Genau dort, wo der Dämon seine Grenzen fand, beginnt die wahre menschliche Größe.
Bildnachweis: ChatGPT – darum die Kennzeichnung mit dem „A“ für artificial.